In den aktuellen Schlagzeilen dreht sich vieles um die Einführung neuer wechselseitiger Zölle gegenüber US-Handelspartnern – und um die Reaktionen dieser Länder darauf. Was mich dabei ehrlich gesagt erstaunt (und ein Stück weit schockiert), ist, wie überrascht viele Marktteilnehmer auf diese Maßnahmen reagiert haben. Dabei hatte die US-Regierung sie schon seit Langem angekündigt. Gleichzeitig scheint es, als hätten sich viele nicht besonders gut gegen solche Entwicklungen abgesichert.
Was ist nun zu erwarten? Länder mit hohen Handelsüberschüssen gegenüber den USA – also solche, die mehr in die USA exportieren, als sie von dort importieren – dürften relativ schnell bereit sein, ihre Handelsschranken abzubauen. Länder, deren Handelsbilanz mit den USA ausgeglichener ist, könnten dagegen eher mit Gegenmaßnahmen reagieren. Es gibt inzwischen viele Analysen zum Thema Zölle – leider basieren viele davon auf schwachen Modellen. Ich habe meine Sicht bereits dargelegt: (a) Die Auswirkungen auf die Preise in den USA werden vermutlich geringer sein, als viele befürchten. (b) Es könnte zu einer sogenannten technischen Rezession kommen – einfach deshalb, weil viele Unternehmen in Erwartung der Zölle ihre Importe in Q1 und Q2 stark vorgezogen haben. (c) Die Beschäftigung in den USA wird eher steigen als sinken. Und (d) außerhalb der USA könnte es dagegen durchaus zu länger anhaltenden Rezessionen kommen. Nicht zu vergessen: (d) dürfte außerdem zu sinkenden globalen Energiepreisen führen – was wiederum (a) stützen würde.
Heute möchte ich jedoch ein anderes Thema ansprechen – eine politische Entscheidung, die tendenziell in die entgegengesetzte Richtung wirkt und die Inflation eher anheizt. Seltsamerweise spricht bisher kaum jemand darüber. Gemeint ist der spürbare Rückgang staatlicher Mittel für Hochschulen und Universitäten. Das wird – insbesondere wenn der Aktienmarkt weiter schwächelt – voraussichtlich zu einem beschleunigten Anstieg der Studiengebühren führen.
Um das besser nachvollziehen zu können, schauen wir uns ein einfaches, aber anschauliches Modell an, wie Studiengebühren zustande kommen. Im Grunde sind die Gewinn- und Verlustrechnungen von Hochschulen nicht besonders kompliziert: Auf der Ausgabenseite stehen vor allem Personalkosten, Betriebskosten für Gebäude und sonstige laufende Ausgaben. Die Einnahmen setzen sich hauptsächlich aus Studiengebühren, staatlicher Finanzierung (bei öffentlichen Einrichtungen) und Stiftungserträgen (bei privaten Hochschulen) zusammen. Zur Veranschaulichung habe ich mir beispielhaft den Jahresbericht der Indiana University angeschaut – die tabellarischen Zahlen finden sich auf Seite 23, ich habe sie hier grafisch aufbereitet.

Wie bereits erwähnt, machen die Ausgaben für Ausgleichszahlungen rund zwei Drittel des Haushalts aus, während sich die Einnahmen etwa zur Hälfte aus Studiengebühren und zu weiteren 20 % aus Bundeszuschüssen und Verträgen zusammensetzen (plus einem kleineren Anteil aus staatlichen und lokalen Mitteln). Manche der "Hilfsunternehmen" oder "sonstigen Einnahmen" können Erträge aus Stiftungen sein – diese spielen allerdings vor allem bei privaten Einrichtungen eine größere Rolle. Wichtig ist dabei: Die Treuhänder haben auf diese Stiftungserträge oder staatlichen Mittel keinen direkten Einfluss, auch wenn sie formal einige der anderen Hebel in der Hand halten.
Zudem ist der Handlungsspielraum der Treuhänder, besonders kurzfristig, bei Gehältern und Sozialleistungen sehr begrenzt – man kann ja nicht einfach festangestellte Professoren entlassen und sie durch günstigere Arbeitskräfte ersetzen.
In der Praxis bleibt also nur ein Hebel, über den die Treuhänder kurzfristig tatsächlich verfügen, um das Budget einer Universität auszugleichen: die Studiengebühren.
Die Ausgaben sind relativ unflexibel und stark von der Inflation beeinflusst (weil die Löhne in der Regel mit der Inflation steigen). Das bedeutet auch, dass die Studiengebühren schneller steigen, wenn die allgemeine Inflationsrate höher ist – und umgekehrt.
Zusätzlich zeigt sich ein Zusammenhang zwischen der Höhe der staatlichen Mittel (oder den Erträgen aus Stiftungen) und der Entwicklung der Studiengebühren: Wenn der Staat mehr beiträgt (oder die Stiftungserträge stark sind), steigen die Studiengebühren langsamer. Wenn staatliche Mittel sinken (oder die Erträge schwach ausfallen), steigen sie schneller.
Hier ist unser Modell, das wir mit einem Index der Studiengebühren an öffentlichen 4-Jahres-Universitäten vergleichen.
Das Modell nutzt ganz einfach die Angaben des College Board zu den staatlichen Mitteln pro Vollzeit-Student aus demselben Bericht – kombiniert mit typischen Aktienrenditen, Anleiherenditen und der Inflationsrate.
Die kleine Abweichung am Ende ist dabei besonders interessant: Sie fällt in die Zeit nach COVID, als die Studiengebühren weniger stark gestiegen sind, als das Modell vorhergesagt hätte. Oder? Ich hatte damals schon geschrieben, dass das Bureau of Labor Statistics weiterhin Qualitätsanpassungen nach unten vornimmt – obwohl viele Hochschulen weitgehend oder vollständig virtuell unterrichtet haben.
Das ist ein Problem – unser Modell geht ja davon aus, dass sich die Bildungsqualität in den COVID-Jahren nicht verändert hat. Abgesehen davon hat das Modell aber ziemlich gut funktioniert.

Worauf ich hinauswill: Wenn die Bundesmittel zurückgehen, steigt auch die erwartete Inflation bei den Studiengebühren – und zwar deutlich. Die Betas in unserem Modell helfen dabei nur bedingt weiter, da sie auf einer homoskedastischen Beziehung basieren. Das heißt, sie gehen davon aus, dass sich der Effekt einer Veränderung (also das Beta) nicht je nach Größe der Veränderung selbst ändert. Aber genau das erscheint hier eher unwahrscheinlich.
Wenn die Bundesmittel pro Student um 10 % sinken, können wir die Auswirkungen mit einer gewissen Sicherheit einschätzen. Aber bei einem Rückgang um 50 % würde vermutlich eine ganze Kaskade an Reaktionen folgen: Die Bundesstaaten würden wohl einen Teil des Verlustes abfedern, die Studiengebühren würden steigen, die Hochschulen müssten versuchen, Kosten zu senken (vielleicht ausnahmsweise auch wirklich), zusätzlich auf mehr Stiftungsgelder zugreifen – und dennoch würden sie finanzielle Einbußen hinnehmen müssen. Selbst unter diesen Bedingungen ist ziemlich sicher, dass die Studiengebühren in einem solchen Szenario einen kräftigen Sprung machen würden.
Als Orientierung dient die folgende Tabelle: Nach der globalen Finanzkrise – und ja, den Stiftungen ging es damals auch nicht gut (es ist nicht ganz einfach, diese beiden eng miteinander verknüpften Effekte sauber voneinander zu trennen) – sanken die Mittel für Bildung vier Jahre in Folge (rote Zellen).
Interessant ist: Obwohl die Gesamtinflation in diesem Zeitraum von 5 % auf -1,4 % fiel und sich dann auf 1,1 %, 3,6 % und 1,7 % erholte, beschleunigte sich die Inflation bei den Studiengebühren zunächst – von 6,6 % auf 7,25 % – bevor sie allmählich wieder etwas nachließ.
Im Studienjahr 2013–2014, als wieder mehr Mittel zur Verfügung standen, stiegen die Studiengebühren dann nur noch um 0,6 % stärker als der Verbraucherpreisindex
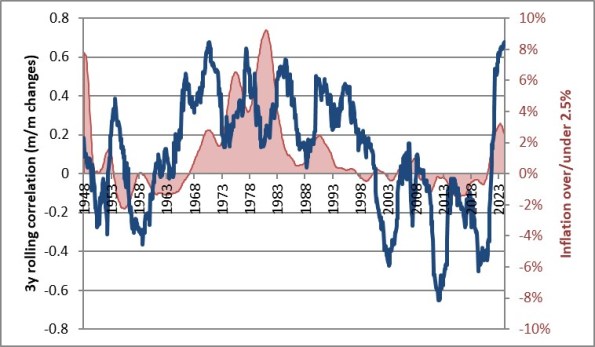
Nehmen Sie nun die Veränderung der zur Verfügung stehenden Mittel von –4 % und setzen Sie stattdessen –30 % ein. Laut Modell würden wir dann mit einer Studiengebühreninflation von etwa 15 % pro Jahr rechnen. Das halte ich für wenig realistisch – und je stärker die Rückgänge bei den Mitteln ausfallen, desto unwahrscheinlicher wird dieses Szenario. Denn irgendwann müssten sich die Hochschulen schlicht anpassen – oder schließen.
Mittelfristig würde ein solcher Rückgang aber ziemlich sicher zu höheren Studiengebühren und geringeren Leistungen führen (wie bitte? Kein Geld mehr fürs Football-Team? Kein All-you-can-eat-Sushi mehr in der Mensa?). Die Betriebsbudgets würden enger, das Hilfspersonal reduziert. Und viele Menschen würden plötzlich feststellen, dass sie eben zum Hilfspersonal gehören.
Kurzfristig ist es schwer abzuschätzen, wie stark diese Entwicklung tatsächlich ausfallen könnte – auch, weil wir nicht wissen, wie tief die Bundeszuschüsse letztlich gekürzt werden.
Aber der übergeordnete Trend ist für mich klar: Die Inflation der Studiengebühren dürfte bald wieder anziehen – und zwar vermutlich deutlich.
